
Ihr kostenfreier* Erstkontakt unter Tel +49 89 595421
FACHANWÄLTIN FÜR ARBEITSRECHT
FACHANWÄLTIN FÜR FAMILIENRECHT
„Nutzen Sie meine Erfahrung für die Durchsetzung Ihrer Ansprüche und ein erfolgreiches Verfahren."
IHRE FACHANWALTSKANZLEI IN MÜNCHEN BOGENHAUSEN
Als Fachanwältin für Arbeitsrecht und Fachanwältin für Familienrecht berate und vertrete ich Sie in München und deutschlandweit. Weitere Tätigkeitsschwerpunkte sind das Verkehrsrecht sowie das allgemeine Schadens- bzw. Schadensersatzrecht.
Sie haben eine Kündigung erhalten oder Fragen zu Ihrem Arbeitsvertrag oder der Beendigung Ihres Arbeitsverhältnisses?
Ich berate und vertrete Sie bei allen Fragen rund um das Arbeitsverhältnis und im Rahmen von Kündigungsschutzklagen und sonstigen Klageverfahren vor dem Arbeitsgericht.
Sie wollen sich trennen oder haben bereits den Entschluss gefasst, sich scheiden zu lassen?
Dann haben Sie sicher viele Fragen, denn Sie stehen vor einer großen Veränderung in Ihrem Leben. Mit meiner Erfahrung und stets aktuellem Wissen als Fachanwältin für Familienrecht stehe ich Ihnen gerne beratend zur Seite.
Sie hatten einen Unfall und wollen Schadensersatz und Schmerzensgeld geltend machen?
Ich unterstütze Sie und setze Ihre Ansprüche gegenüber der Versicherung des Unfallgegners durch. In einem ersten Gespräch erkläre ich Ihnen, worauf es nun ankommt und in welcher Höhe Sie Ersatz für materielle Schäden und unfallbedingte Verletzungen erwarten können.
Sie sind von einem Hund gebissen worden und wollen Schadensersatz und Schmerzensgeld geltend machen?
Auch bei Beteiligung des eigenen Hundes bestehen häufig Ansprüche gegenüber der Haftpflichtversicherung des anderen Hundehalters. Ob und in welcher Höhe Sie Ansprüche auf Schadensersatz haben, kläre ich gerne mit Ihnen im Beratungsgespräch.





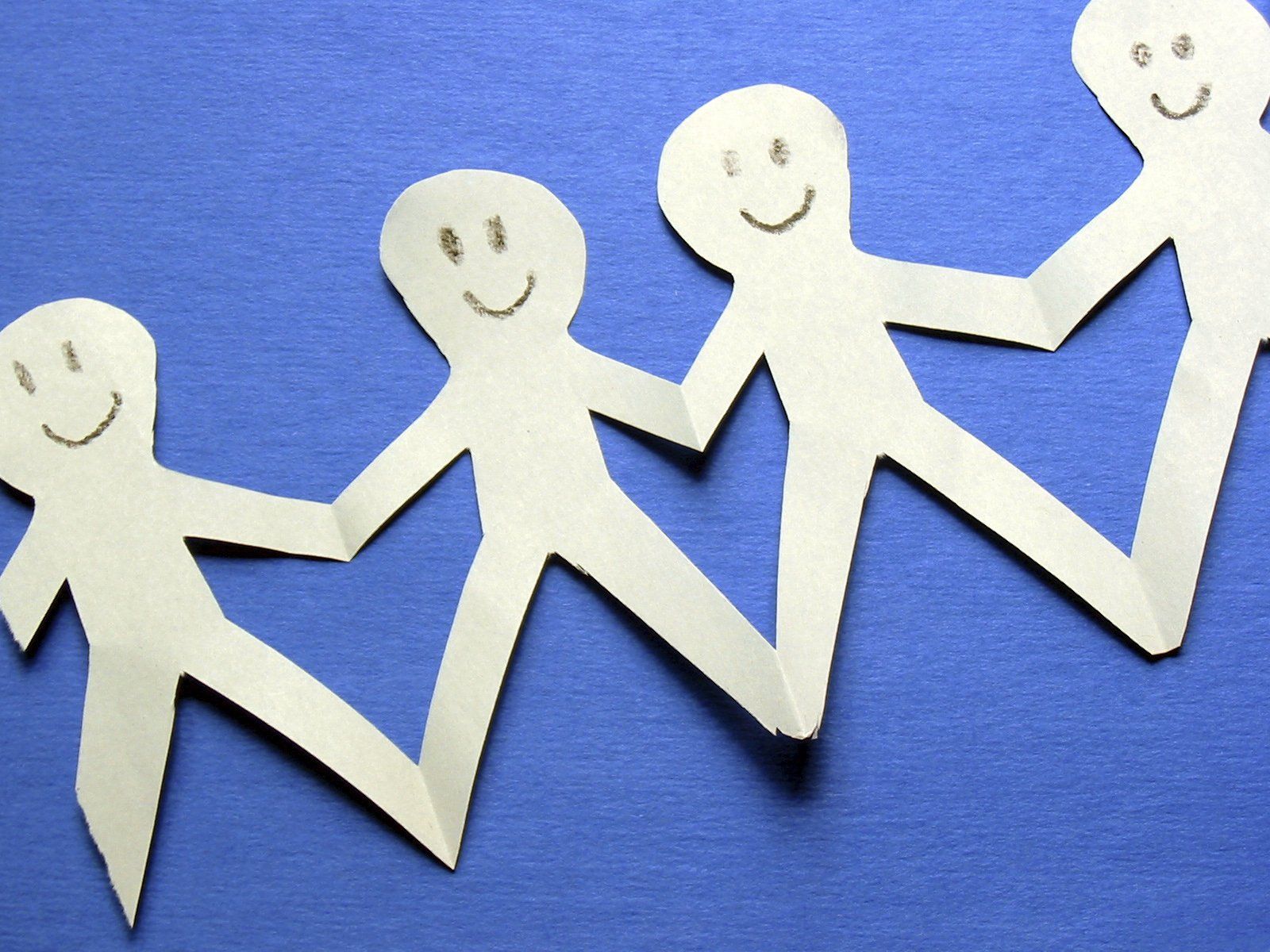




IHRE FACHANWALTSKANZLEI IN MÜNCHEN BOGENHAUSEN
FÜR EIN ERSTES BERATUNGSGESPRÄCH
KONTAKTIEREN SIE MICH GERNE
Sie finden meine Kanzlei im Münchner Osten, Bogenhausen/Englschalking
- nahe Arabellapark/Cosimabad
- U-Bahn Haltestelle Arabellapark (U4)
- Trambahn-Haltestelle Cosimabad (Linien 16/17)
- Bus 154, 183, 184
- Parkplätze vorhanden

Burgmeier Brüseken Haußleiter
81927 München
+49 177 288 2973
info@engels-recht.de
In Bürogemeinschaft mit
Rechtsanwaltskanzlei
